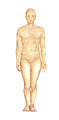Die Harnblase ist ein Hohlorgan, das mittig im Beckenbereich vor dem Mastdarm liegt. Sie speichert die von den Nieren abgespaltene Restflüssigkeit (Urin), bevor dieser durch die Harnröhre ausgeschieden wird. Ihr maximales Fassungsvermögen beträgt beim Erwachsenen je nach Körpergröße zwischen 900 – 1500 cm³, wobei die männliche Blase i.d.R. etwas größer als die weibliche ist.
Die menschliche Harnblase (Vesica urinaria) ist ein im unteren Bauchraum auf dem Beckenboden aufliegendes Hohlorgan, das dem Zwischenspeichern des kontinuierlich von den Nieren über die Harnleiter zufließenden Urins dient, bis dieser durch eine im Normalfall bewusst gesteuerte (willentliche) Entleerung ausgeschieden wird. Ihr Fassungsvermögen beträgt beim Erwachsenen um die 300-500 ml, eine prall gefüllte Blase kann manchmal auch mehr als einen Liter Urin enthalten. Äußerlich besteht die Harnblase aus vom Bauchfell bedeckten, gut verschiebbaren Bindegewebe mit darunter liegender, netzartiger Muskelschicht. Ihr Inneres ist mit mehrschichtiger Schleimhaut (Urothel) ausgekleidet.
Die Form der Harnblase variiert mit ihrem Füllungsgrad: Eine leere bis mäßig gefüllte Blase zeigt eine Schalenform, die bei zunehmende Füllung zu einer sich nach oben in den Bauchraum ausdehnenden Kugel wird. In die Oberseite der Harnblase münden die von den Nieren kommenden Harnleiter. Bei steigendem Füllgrad werden die ins Innere der Blase herein ragenden Endstücke der Harnleiter abgeknickt, was ein Zurückfließen des Urins verhindert. Die leicht trichterförmige Unterseite der Harnblase (Blasenhals) bildet den Ausgang bzw. Übergang zur Harnröhre. Dort befinden sich ein innerer und äußerer Schließmuskel (Sphinkter). Während der innere durch das vegetative Nervensystem gesteuert wird und somit nicht willentlich beeinflussbar ist, ermöglicht der äußere Schließmuskel durch kontrolliertes An- und Entspannen eine Entleerung zum gewünschten Zeitpunkt.
Sensoren des Nervensystems signalisieren dem Gehirn schon ab etwa 80 ml Inhalt eine Füllung der Blase, starker Harndrang stellt sich ab einem Füllgrad von etwa 300 ml ein, bei Erkrankungen (Reizung, Infektion etc.) auch früher.
Ähnliche Symptome wie bei einer bakteriellen Blasentzündung bestehen beim Krankheitsbild der Reizblase, wovon hauptsächlich Frauen mittleren Alters betroffen sind. Die Diagnose „Reizblase“ wird gestellt, wenn kein anderer Krankheitsbefund des Organs feststellbar ist. Hier kommen hormonelle oder psychosomatische Ursachen in Betracht.